Nachdem wir uns im letzten Teil dieser Reihe mit einer nicht-invasiven Art des Monitorings beschäftigt haben, soll es heute um eine deutlich genauere, aber auch deutlich aufwändigere Technik gehen: die Wildtier-Telemetrie. Wie so häufig hat sich auch diese Technologie über die Zeit hin weiterentwickelt, sodass es neben der klassischen Radio-Telemetrie zum manuellen Triangulieren mittlerweile auch automatisierte Auswertungen von GPS-Sendern gibt. Aber fangen wir doch mal am Anfang an…
Was ist Telemetrie überhaupt? Im Deutschen kann man die Technik als „Fernmessung“ bezeichnen, was schon recht gut beschreibt, dass es dabei um die Übertragung von Informationen in eine gewisse Entfernung geht. Im Kontext der Arbeit mit Wildtieren bedeutet das, dass ein Tier einen Sender angelegt bekommt, der entsprechend Informationen über dieses Tier an einen Empfänger schickt.
Mit der Antenne in der Hand – Radio-Telemetrie
Das klingt so erst mal ziemlich abstrakt, da hier generell verschiedene Technologien genutzt werden können. Die klassische Form davon funktioniert über Radiowellen, wie eben das klassische UKW-Radio und auch mit den von dort bekannten, typischen Störgeräuschen und Empfangsproblemen je nach Position.
Man kann sich das also so vorstellen, dass der Sender (am Tier) durchgehend vielleicht einmal pro Sekunde eine Radiowelle ausstößt, die sich dann kugelförmig davon ausbreitet. Damit ist diese Welle aus allen Richtungen und je nach Frequenz bis in eine bestimmte Entfernung auffindbar. Das macht man mit dem Empfänger, der dafür eine entsprechende Antenne braucht und diese Welle dann wiederum in ein auswertbares Signal umwandelt.
In dem Anwendungsfall der Wildtier-Telemetrie nutzt man hierzu typischerweise einen Frequenzbereich, mit dem man nicht allzu viel Strom für die Erzeugung des Signals verbraucht und dieses aus wenigen Kilometern Entfernung noch wahrnehmen kann. Für das typische Monitoring, bei dem man das Tier in einem geschützten Gebiet finden oder ihm nach der Entlassung für eine gewisse Strecke folgen möchte, ist das ausreichend.

(© Sebastian Sperling, 2024)
Ich kenne diese Technik vor Allem aus Südafrika, wo Halsbänder mit entsprechenden Sendern für die besonders schützenswerten Tierarten genutzt werden. So ein Halsband kann dabei mit der entsprechenden Batterie für mehrere Jahre genutzt werden, sodass die Tiere damit langfristig verfolgt werden können.
Dazu bekommt jedes Halsband eine bestimmte Frequenz (mit etwas Puffer zur nächsten vergebenen Frequenz) zugewiesen, damit die Tiere eindeutig identifizierbar sind. Als Empfänger wird dann ein handliches Gerät mit Lautsprecher und kleinem schwarz-weißen Bildschirm verwendet, in dem diese Frequenzen einprogrammiert werden können und das die Signalstärke grafisch und auditiv anzeigt. Um das Signal besser und stärker wahrnehmen zu können, schließt man daran eine passende Antenne an.


An sich ist die Verwendung dann recht einfach: man wählt die passende Frequenz für das entsprechende Tier bzw. dessen Halsband und sucht mit der Antenne einmal alle Richtungen ab. In irgendeiner Richtung macht es dann regelmäßig „Piep“ – also befindet sich das Tier dort. Doch leider klingt das leichter, als es in Wirklichkeit ist: Radiowellen werden nämlich durch das Wetter und die regionalen Gegebenheiten beeinträchtigt. So können sich die Wellen zwar gut durch die Luft ausbreiten, aber durch einen Hügel kommen sie nicht durch. Und noch schlimmer: von Bergwänden können sie sogar zurückgeworfen werden und so zu Fehlsignalen führen!
Daher will auch die Arbeit mit dem Telemetrie-Equipment gelernt werden. Am besten sucht man sich für die initiale Suche einen recht hoch gelegenen Ort, sodass man eine möglichst offene Sichtlinie auf das ganze relevante Gelände hat. Hat man dann die generelle Richtung gefunden und sich dem Tier weiter genähert, bekommt man bald aus gefühlt allen Richtungen ein Signal – nun sollte man die Empfindlichkeit des Geräts runterdrehen, bis man nur noch das stärkste Signal wahrnimmt. Anhand der Signalstärke lässt sich mit etwas Übung auch die Entfernung abschätzen, wenn man die Vegetation der Umgebung mit bedenkt.

(© Sebastian Sperling, 2024)

(© Sebastian Sperling, 2024)
Aus meiner Erfahrung lernt man die Grundlagen recht schnell – bei Wildlife ACT durften wir Volunteers alle lernen, wie man mit dem Equipment passend umgeht, und schnell konnten wir alle recht sicher die passende Richtung bestimmen. Wenn es aber in unwegigem Gelände mal schnell gehen muss, dann wurde es schon schwieriger und die Monitors mussten selber ran. Als ich aber im Rahmen meiner Masterarbeit zwei Monate lang täglich dabei war, durfte ich den Job auch selber mal übernehmen und hab auch kleinere Änderungen in der Signalstärke schneller wahrgenommen. Also alles eine Frage der Übung.
In der praktischen Verwendung ist diese doch recht einfache Technologie häufig genau genug, um die gesuchten Tiere zu lokalisieren und oft auch direkt zu Gesicht zu bekommen. Dazu folgt man dem Signal nicht nur in eine Richtung, sondern versucht, eine Triangulation durchzuführen. Das bedeutet, dass man mehrere Messungen durchführt, um den Aufenthaltsort des Tieres besser einschränken zu können – bei einer einzelnen Messung bekommt man ja nur eine Richtung, aber keine klare Entfernung. Wenn man nun zwei oder drei Messungen kombiniert und diese nicht aus der gleichen Richtung durchführt, dann lässt sich ein Gebiet bestimmen, in dem sich das Tier aufhalten muss.
Oder vom Computer aus – die GPS-Ära
Trotzdem bleibt die Radio-Telemetrie ein manueller Aufwand und im Zweifel immer etwas ungenau. Wenn man also exakt bestimmen möchte, wo sich ein Tier zu welcher Zeit befindet, dann ist diese Technik nicht ausreichend. Doch auch dafür gibt es mittlerweile passende Methoden und Sender-Halsbänder.
Die zweite Generation der Besenderung setzt daher auf die GPS-Technologie, die heutzutage ja generell zur Ortung verwendet wird. Im Gegensatz zu einem Handy, das man für die Ortung einfach als Empfänger für die GPS-Signale verwendet, handelt es sich bei den Halsbändern aber um aktive Sender. Das bedeutet, dass diese ein erkennbares Signal aussenden, das über die Satelliten geortet werden und beispielsweise auf dem Computer angezeigt werden kann.
Besonders die frühen Exemplare dieser Sender brauchten aber deutlich mehr Strom als die Generierung von Radio-Wellen, sodass hierbei häufig keine Live-Ortung möglich war, sondern vielleicht stündlich oder alle drei Stunden die aktuelle Position bestimmt wurde. Das ist dann zwar für das Erstellen von generellen Bewegungsprofilen absolut ausreichend, und wird dafür auch häufig verwendet, aber eignet sich weniger für aktives Monitoring.

(© Cornelia Hebrank, 2024)

Dennoch gab es mit diesen Sendern einige wirklich faszinierende Erkenntnisse, da man dem besenderten Tier nun eben nicht mehr aktiv folgen musste und so auch weitere Strecken abdecken konnte. Somit wurde beispielsweise der Flug von Störchen von Europa nach Afrika verfolgt oder auch der Weg eines gestohlenen Nashorn-Horns quer durch Afrika. Auch über das Wanderungsverhalten von Wölfen ließen sich damit ganz neue Daten gewinnen, also die Technologie hat definitiv ihre Einsatzbereiche. Und bei Gelegenheit kann ich euch ja mal noch mehr über solche Auswertungen erzählen und was man dabei gelernt hat.
Mittlerweile gibt es zusätzlich auch kombinierte Sender-Halsbänder, die sowohl ein Radio- als auch ein GPS-Signal aussenden können. Diese sind damit für das Monitoring von bedrohten Arten wieder richtig nützlich, da man die Tiere so auch dann wieder findet, wenn sie sich weiter als erwartet aus ihrem Gebiet entfernt haben. So kam es beispielsweise schon vor, dass ein Rudel von Hyänenhunden ausgebrochen ist und dann für ein paar Tage durch ein benachbartes Schutzgebiet streifte – wegen des GPS-Signals wurden sie dort wenige Stunden später auch direkt wieder gefunden…
Auswirkungen auf die Tiere
Allerdings darf man bei dieser Thematik einen wichtigen Aspekt nicht aus den Augen verlieren: die besenderten Tiere selbst. Gerade zu Beginn der Besenderung waren die Methoden nicht wirklich ausgereift und die Sender führten teilweise zu Verletzungen oder sogar zum Tod der besenderten Tiere. Das passiert heute glücklicherweise nur noch in absoluten Ausnahmefällen, aber dennoch ist es ein großer Eingriff in das Leben des Tieres, wenn ihm so etwas angelegt wird.
In allen Fällen muss das Tier dafür gefangen und fast immer auch betäubt werden, damit eine sinnvolle Befestigung des Senders möglich ist. Das darf heute nur mit Genehmigung der Tierschutzbehörde oder ähnlichem durchgeführt werden und grundsätzlich unter Aufsicht eines ausgebildeten Tierarztes. Entsprechend muss vorher geklärt sein, warum diese Besenderung erfolgt und dass sie für das Management oder die Forschung an der Art notwendig ist.
Spielen wir das Ganze mal am Beispiel von typischen afrikanischen Raubtierarten durch: ich hatte nämlich das Glück, schon selbst bei der Besenderung von Hyänenhunden und Geparden dabei zu sein. Zunächst folgt man dem relevanten Tier und ruft dann den Tierarzt samt Betäubungsgewehr dazu, der im besten Fall direkt beim ersten Versuch das Tier erfolgreich betäubt. Nun heißt es aufmerksam bleiben und das noch für wenige Minuten umhertorkelnde Tier im Blick behalten – schließlich möchte man nicht, dass ihm etwas passiert, wenn es sich nicht mehr wehren kann.

Hat man das betäubte Tier nun gefunden, wird es an einen offenen, ebenen Ort gelegt und bekommt einen Augenschutz aufgesetzt, damit die afrikanische Sonne es nicht zu sehr blendet und die Augen auch nicht austrocknen. Dann bleibt es unter der Aufsicht des Tierarztes und wird vermessen, während ein passendes Sender-Halsband ausgesucht wird. Hierbei ist es wichtig, dass die Größe genau passt: zu weit, und das Tier kann das Band abstreifen oder im Zweifel damit hängen bleiben; zu eng, und das Tier bekommt vielleicht schlechter Luft oder ist in seiner Bewegung eingeschränkt.
Wenn das Halsband passend gewählt wurde, dann wird es vor dem Anlegen nochmals auf sein klares Signal geprüft und die Frequenz entsprechend eingespeichert und notiert. Dann bekommt das Tier es angelegt und wird danach möglichst schnell wieder durch den Tierarzt aufgeweckt – am besten im Schatten liegend. Wenn es wieder wach wird, dann merkt man ziemlich, dass es erst wieder fit werden muss, aber das Halsband scheint meistens erstmal nicht zu sehr zu stören. Tatsächlich habe ich sogar Geschichten gehört, dass das Tier mit Halsband in seiner Gruppe danach als besonders behandelt wurde und sich dadurch sogar der soziale Status geändert hat.

(© Cornelia Hebrank, 2016)

Aber ich glaube es wird schon klar: ein solcher Eingriff birgt natürlich immer Risiken und sollte nicht zu häufig vorgenommen werden. Daher werden besonders bei gruppenlebenden Tieren meist nur ein bis zwei Individuen pro Rudel oder Herde besendert, da man damit die ganze Gruppe verfolgen kann.
Auch die Größe der Tiere ist relevant: je kleiner das Tier, desto mehr wird es durch den Sender und dessen Batterie, die halt doch etwas wiegen, behindert. Entsprechend kann für einen Elefanten beispielsweise auch ein größeres Halsband genutzt werden als für einen Löwen. Besonders bei Vögeln ist das immer ein schwieriges Thema, sodass meist nur große Vögel wie Geier mit sogenannten Rucksäcken besendert werden, während sich bei den kleineren Arten die Markierung durch nicht sendungsfähige Ringe gehalten hat.
Wie so oft ist es also wichtig, den Einsatz von Wildtier-Telemetrie bewusst durchzuführen. Wenn die Technologie aber dazu beitragen kann, die Tiere besser zu schützen oder mehr über sie zu lernen, um sie dann sinnvoll managen zu können, dann überwiegen die Vorteile klar. Doch auch dann sollte man vorsichtig sein: es gab schon Fälle, bei denen die Daten über besenderte Nashörner in die falschen Hände gefallen sind und dann für die Wilderei missbraucht wurden.
Damit aber genug zur Telemetrie. Ich hoffe, der Eintrag hat euch gefallen und ich konnte die technischen Teile durch meine Erfahrungen ein bisschen spannender gestalten. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Serie haltet – findet ihr diese Einblicke in die Naturschutz-Methodik auch interessant?
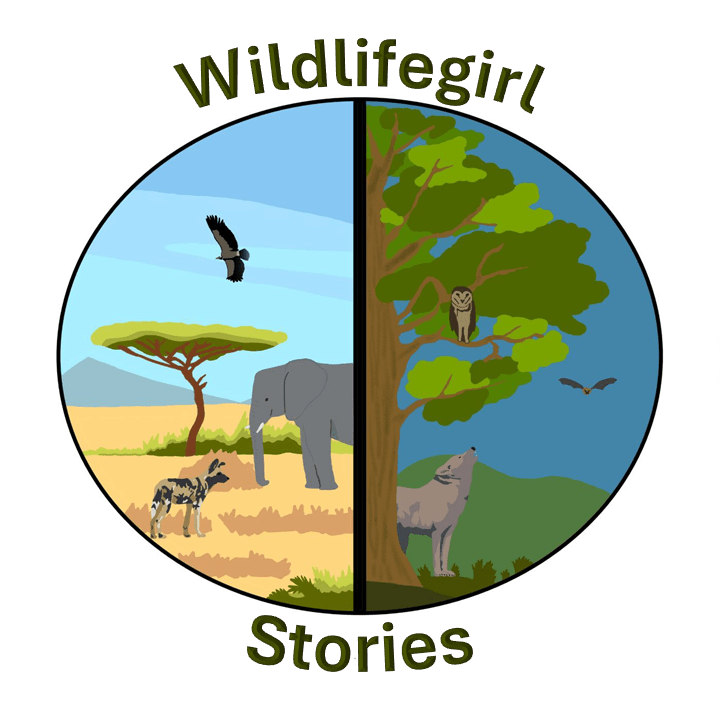

Hinterlasse einen Kommentar